Scheidung mit Haus: Was passiert mit der Immobilie bei einer Trennung?
Wenn die Liebe endet, bleibt oft das Haus – und mit ihm die Frage, was damit passiert. Bei einer Scheidung mit Immobilie geht es nicht nur um Emotionen, sondern um erhebliche Werte, rechtliche Pflichten und finanzielle Entscheidungen, die gut überlegt sein sollten. Mit der richtigen Planung können Sie hohe Kosten vermeiden, Stress ersparen und auch in turbulenten Zeiten ein stabiles familiäres Umfeld beibehalten.
Das Wichtigste in Kürze
- In den meisten Fällen wird das Haus bei Scheidung verkauft oder ein Partner zahlt den anderen aus – beides gilt als faire und angenehme Lösung in der Praxis.
- Die Kosten einer Scheidung mit Hausbesitz hängen vom Immobilienwert, den Gerichts- und Anwaltskosten sowie möglichen Gutachten ab. Auch ein faires Miteinander spart Geld.
- Bei laufenden Krediten oder neuen Finanzierungen für das Haus bei Scheidung ist entscheidend, wer die Raten künftig trägt und ob die Bank einer Vertragsänderung zustimmt.
Direkt zum Wunschthema
- Was passiert mit dem Haus bei Scheidung?
- Welche Rolle spielen Gütergemeinschaft und Zugewinngemeinschaft?
- Was gilt bei Scheidung, wenn das Haus einem Alleineigentümer gehört?
- Was passiert mit dem gemeinsamen Haus bei Scheidung?
- Wohnrecht, Nutzungsrecht und Nutzungsentschädigung – wann gilt was?
- Was passiert bei einer Scheidung mit dem laufenden Hauskredit?
- Steuern bei der Scheidung mit Haus: Was gilt es steuerrechtlich zu beachten?
- Welche Kosten entstehen bei einer Scheidung mit Hausbesitz?
- Trennung oder Scheidung – Welche Unterschiede gelten für Immobilien?
- Fazit: Wie sieht der ideale Ablauf bei einer Scheidung mit Haus aus?
1. Was passiert mit dem Haus bei Scheidung?

Bei einer Scheidung mit Immobilie stellt sich oft die entscheidende Frage: Was passiert mit dem gemeinsamen Haus? Die Antwort hängt vor allem davon ab, wer im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist und welche finanziellen Möglichkeiten bestehen. Gehört das Haus bei Scheidung beiden Ehepartnern, kommen eine Auszahlung, ein gemeinsamer Verkauf oder eine andere einvernehmliche Lösung infrage. Gelingt keine Einigung, findet im schlimmsten Fall eine Teilungsversteigerung statt.
Nur einer steht im Grundbuch: Wer bekommt das Haus bei Scheidung?
Steht bei einer Scheidung nur einer im Grundbuch, bleibt dieser grundsätzlich Alleineigentümer. Der andere Partner hat dann kein automatisches Anrecht auf das Haus, kann jedoch unter Umständen Ausgleichsansprüche geltend machen – etwa, wenn er zur Finanzierung oder Instandhaltung beigetragen hat. Eigentumsverhältnisse und der Zugewinnausgleich spielen hierbei eine zentrale Rolle.
Gibt es Unterschiede im Umgang mit der Immobilie bei Scheidung und Trennung?
Während bei einer Trennung die Ehe noch besteht, bleibt das Eigentum rechtlich unangetastet. Wer in der Immobilie bei Trennung wohnt, kann sich jedoch auf ein vorübergehendes Nutzungsrecht berufen. Erst mit der Scheidung werden die Vermögenswerte endgültig auseinanderdividiert – also auch das Haus. Dann entscheidet sich, ob ein Partner die Immobilie übernimmt, sie verkauft oder eine andere Lösung gefunden werden muss.
2. Welche Rolle spielen Gütergemeinschaft und Zugewinngemeinschaft?
Bei einer Scheidung mit Haus spielt nicht nur das Grundbuch eine Rolle, sondern auch der sogenannte Güterstand. Er bestimmt, wem das während der Ehe aufgebaute Vermögen gehört – und damit auch, wie eine Immobilie bei Scheidung aufgeteilt wird. In Deutschland gilt ohne Ehevertrag automatisch die Zugewinngemeinschaft, während die Gütergemeinschaft ausdrücklich vereinbart werden muss. Beide Modelle unterscheiden sich deutlich: Während in der Gütergemeinschaft alle Vermögenswerte zu einem gemeinsamen Besitz verschmelzen, bleibt in der Zugewinngemeinschaft das individuelle Eigentum bestehen.
Zugewinngemeinschaft: Alleiniges Vermögen und gemeinsamer Vermögenszuwachs
Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Standard, wenn kein Ehevertrag besteht. In diesem Güterstand bleiben beide Ehepartner Eigentümer ihres individuellen Vermögens, auch von Immobilien. Das bedeutet: Bringt einer von beiden ein Haus in die Ehe mit, bleibt es grundsätzlich in seinem alleinigen Besitz. Erst der während der Ehe entstandene Vermögenszuwachs – also der sogenannte Zugewinn – wird im Falle einer Scheidung ausgeglichen.
Für die Berechnung wird das Anfangsvermögen beider Partner mit dem Endvermögen verglichen. Derjenige, der während der Ehe einen höheren Zugewinn erzielt hat, muss die Hälfte dieses Überschusses an den anderen auszahlen. Steigt also der Wert einer Immobilie bei Scheidung deutlich an, fließt dieser Wertzuwachs in die Berechnung ein. Die Immobilie selbst bleibt jedoch im Eigentum desjenigen, der sie erworben oder in die Ehe eingebracht hat.
immoverkauf24 Hinweis
Mit der Scheidung endet die Zugewinngemeinschaft automatisch – und das gemeinsame Vermögen wird gemäß § 1363 BGB ausgeglichen. Eine frühzeitige Wertermittlung Ihrer Immobilie hilft, faire Ausgleichszahlungen festzulegen und unnötige Konflikte oder teure Gutachten im Nachhinein zu vermeiden.
Gütergemeinschaft: Vermögenswerte fließen zusammen
In einer Gütergemeinschaft verschmelzen die Vermögen beider Ehepartner zu einem Gesamtvermögen (Gesamtgut). Dazu zählen auch Immobilien, die einer der Partner bereits vor der Ehe besessen hat – etwa ein Haus, das in die Ehe mitgebracht wurde. Damit wird die Immobilie gemeinsames Eigentum, und bei einer Scheidung mit Haus steht grundsätzlich beiden ein Anteil zu. Nur wenn bestimmte Vermögenswerte als sogenanntes Sondergut oder Vorbehaltsgut notariell festgelegt wurden, bleiben sie im Alleineigentum eines Partners.
Diese Form des Güterstands kann bei einer Scheidung erhebliche Auswirkungen haben, da alle im Gesamtgut befindlichen Vermögenswerte – einschließlich Immobilien – aufgeteilt oder verwertet werden müssen. Wer verhindern möchte, dass eine mitgebrachte Immobilie in die gemeinsame Vermögensmasse fällt, kann dies nur durch eine Gütertrennung oder entsprechende Klauseln im Ehevertrag regeln.
3. Was gilt bei Scheidung, wenn das Haus einem Alleineigentümer gehört?
Gehört das Haus nur einem Ehepartner, bleibt dieser bei einer Scheidung mit Haus grundsätzlich Alleineigentümer. Der Eintrag im Grundbuch ist entscheidend – er bestimmt, wem die Immobilie bei Scheidung rechtlich gehört. Selbst wenn der andere Ehepartner während der Ehe im Haus gewohnt oder sich an Krediten beteiligt hat, ändert das nichts am Eigentum. Allerdings können Ausgleichsansprüche entstehen, etwa über den Zugewinnausgleich oder durch die Rückforderung ehebedingter Zuwendungen, wenn der nicht eingetragene Partner finanzielle Mittel in das Haus investiert hat. Das gilt auch, wenn der Eigentümer das Haus mit in die Ehe gebracht hat und es später an Wert gewonnen hat.
Was ist der Zugewinnausgleich und wann ist er wichtig?
Der Zugewinnausgleich spielt bei einer Scheidung mit Haus eine zentrale Rolle, sofern die Ehe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft geführt wurde. Dabei wird ermittelt, wie stark das Vermögen jedes Ehepartners während der Ehe gewachsen ist. Hat der Eigentümer eine Immobilie bei Scheidung, deren Wert während der Ehe gestiegen ist, wird dieser Zugewinn anteilig in die Berechnung einbezogen. Der andere Ehepartner kann somit einen finanziellen Ausgleich verlangen, auch wenn er nicht im Grundbuch steht.
Ein Ehevertrag kann diesen Anspruch jedoch ausschließen oder individuell regeln. Dadurch lässt sich der Zugewinnausgleich bei einer Immobilie umgehen, sofern die Vereinbarung notariell beurkundet und rechtlich wirksam ist. Ohne eine solche vertragliche Regelung gilt der gesetzliche Güterstand – und damit fließt auch der Wertzuwachs des Hauses in die Vermögensaufteilung ein.
4. Was passiert mit dem gemeinsamen Haus bei Scheidung?
Bei einer Scheidung mit Haus stehen viele Paare vor der Frage, wie es mit der gemeinsamen Immobilie weitergeht. Sind beide Ehepartner im Grundbuch eingetragen, bleiben sie zunächst Miteigentümer – auch nach der Scheidung. Dann ist eine Einigung entscheidend: Wer soll im Haus wohnen bleiben, wird das Eigentum geteilt oder gar verkauft? Eine offene Kommunikation und klare rechtliche Regelungen helfen, Konflikte zu vermeiden und eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden. Mit den folgenden Möglichkeiten können Sie Ihr Haus bei Scheidung ohne juristische Unterstützung aufteilen:
Haus verkaufen bei Scheidung
Ein gemeinsamer Hausverkauf bei Scheidung ist die häufigste und meist unkomplizierteste Lösung. Das Haus wird zum aktuellen Marktwert verkauft, offene Kredite werden abgezogen und der verbleibende Erlös geteilt. Wichtig ist jedoch, dass beide Partner dem Verkauf zustimmen müssen. Möchten Sie Ihr Haus bei Scheidung verkaufen, kommt es außerdem darauf an, ob Sie einen Ehevertrag haben oder nicht.
- Hausverkauf ohne Ehevertrag
Liegt kein Ehevertrag mit abweichenden Regelungen vor, gilt beim Hausverkauf im Rahmen einer Scheidung automatisch die gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft. Der Erlös aus dem Hausverkauf wird dabei in der Regel zu gleichen Teilen auf beide Partner verteilt.
Ein Verkauf ist meist die einfachste Lösung, um das im Haus gebundene Vermögen gerecht aufzuteilen. Möchte einer der Ehepartner in der Immobilie bleiben, muss er den anderen hälftig auszahlen. Den aktuellen Verkehrswert bestimmt ein Sachverständiger per Gutachten – eine erste Orientierung bietet unsere kostenlose Immobilienbewertung.
- Hausverkauf mit Ehevertrag
Ein Ehevertrag regelt detailliert, wie verheiratete Paare im Falle einer Scheidung das Vermögen aufteilen. Ein gemeinsam finanziertes Haus bildet mit hoher Wahrscheinlichkeit den größten Vermögenswert. Daher sollte der Ehevertrag vor allem folgende Punkte klären:
- Soll das Haus bei einer Scheidung verkauft werden oder bleibt eine Partei in ihm wohnen?
- Welche Ausgleichszahlungen werden an den Ex-Partner gezahlt, der das Haus verlässt?
- Wie wird mit gemeinsamen Krediten für die Hausfinanzierung umgegangen?
- Gibt es eine Gütertrennung, die das Haus umfasst?
Eine solche Regelung kann auch nach der Eheschließung im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung getroffen werden. Damit ersetzen die individuell vereinbarten Punkte die gesetzlichen Vorgaben der Zugewinngemeinschaft – etwa, dass ein Ehepartner die Immobilie behält und den anderen durch Ausgleichszahlungen entschädigt.
Nur einer will das gemeinsame Haus verkaufen – was nun?
Möchte nur ein Ehepartner das Haus bei Scheidung verkaufen, kann er den anderen nicht einfach dazu zwingen. Ohne beiderseitige Zustimmung bleibt nur der Weg über die Teilungsversteigerung – meist mit finanziellen Nachteilen. Eine gütliche Einigung ist fast immer die bessere Lösung.
Das Haus bei Scheidung auszahlen
Möchte einer der Ehepartner das gemeinsame Haus behalten, kann er den anderen durch eine Auszahlung abfinden. Grundlage bildet der aktuelle Verkehrswert der Immobilie, von dem noch bestehende Kredite abgezogen werden. Die verbleibende Summe wird anschließend halbiert, sodass der ausziehende Partner seinen Anteil als finanziellen Ausgleich erhält. Voraussetzung ist, dass der verbleibende Eigentümer die Finanzierung künftig allein übernehmen kann – in der Regel über eine Umschuldung oder einen neuen Kredit. Ein Sachverständigengutachten sorgt dabei für Transparenz und eine faire Berechnungsgrundlage.
Realteilung der Immobilie bei Scheidung
In seltenen Fällen ist eine Realteilung der Immobilie möglich. Dabei wird das Haus – sofern baulich machbar – in zwei getrennte Wohneinheiten aufgeteilt, etwa bei einem großen Haus oder einem Mehrfamilienhaus. Beide Ex-Partner erhalten dann jeweils einen rechtlich eigenständigen Teil der Immobilie und können diesen selbst bewohnen oder vermieten. Voraussetzung ist eine Teilungserklärung beim Notar und die Zustimmung beider Parteien. Diese Lösung vermeidet den Verkauf, setzt aber eine kooperative Basis und geeignete bauliche Strukturen voraus.
Übertragung des Hauses auf gemeinsame Kinder (mit Wohnrecht)
Manche Paare entscheiden sich dazu, die Immobilie bei Scheidung an die gemeinsamen Kinder zu übertragen – etwa um das Familienvermögen zu erhalten. Sind die Kinder volljährig, ist die Übertragung per notarieller Schenkung möglich. Bei minderjährigen Kindern muss das Vormundschaftsgericht zustimmen. Eltern können sich anschließend von ihren Kindern ein Wohnrecht einräumen lassen, behalten aber keine Eigentumsrechte mehr. Diese Lösung erfordert sorgfältige Planung, da die Kinder mit der Übertragung auch sämtliche Pflichten und Kosten der Immobilie übernehmen.
Haus vermieten nach Scheidung
Statt Verkauf oder Auszahlung können Paare die Immobilie nach der Scheidung vermieten. Die Mieteinnahmen werden dann anteilig aufgeteilt. Diese Lösung schafft ein regelmäßiges Einkommen, erfordert aber gemeinsame Entscheidungen über Verwaltung, Instandhaltung und steuerliche Pflichten. Um Streit zu vermeiden, sollten beide Parteien ihre Rechte und Pflichten vertraglich festhalten – idealerweise mit juristischer Unterstützung. Diese Option kann langfristig vor allem dann interessant sein, wenn der Immobilienwert weiter steigen soll.
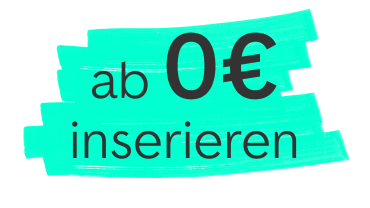
Anzeige
Jetzt ab 0€ Mieter oder Käufer finden bei ImmoScout24
- ✓ Einfach und schnell inserieren dank Vorlagen und Tipps
- ✓ Hohe Reichweite beim führenden Immobilienportal
- ✓ Passende Interessenten persönlich auswählen
Teilungsversteigerung der Immobilie bei Scheidung
Wenn keine Einigung gelingt, bleibt als letzter Ausweg die Teilungsversteigerung. Dabei kann ein Partner beim Amtsgericht die Versteigerung der gemeinsamen Immobilie beantragen – auch ohne Zustimmung des anderen. Das Haus wird öffentlich versteigert und der Erlös nach Abzug der Kosten aufgeteilt. Diese Variante gilt als wirtschaftlich ungünstigste Lösung, da meist ein niedrigerer Verkaufspreis erzielt wird und zusätzliche Gebühren für Gericht und Gutachten anfallen. Eine Teilungsversteigerung sollte daher nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden, wenn alle anderen Optionen scheitern.
5. Wohnrecht, Nutzungsrecht und Nutzungsentschädigung – wann gilt was?
Bei einer Scheidung mit Haus stellt sich oft die Frage, wer in der Immobilie nach der Trennung wohnen darf – und unter welchen Bedingungen. Während ein Partner meist auszieht, möchte der andere häufig in der gewohnten Umgebung bleiben. Hier kommen Wohnrecht, Nutzungsrecht und Nutzungsentschädigung ins Spiel. Sie regeln, wer die Immobilie weiterhin bewohnen darf, welche Rechte bestehen und ob ein finanzieller Ausgleich gezahlt werden muss. Diese Regelungen sind entscheidend, um Streit zu vermeiden und eine faire Aufteilung der Nutzung zu gewährleisten.
| Wohnrecht | Nutzungsrecht | |
|
Definition |
Dauerhaftes, grundbuchlich gesichertes Recht, eine Immobilie oder einen Teil davon zu bewohnen. |
Zeitlich begrenztes Recht, die Immobilie während der Trennungsphase weiterzunutzen. |
|
Rechtsgrundlage |
Wird notariell vereinbart, im Grundbuch eingetragen und bleibt auch bei Eigentümerwechsel bestehen. |
Kann gerichtlich oder einvernehmlich geregelt werden. Kein Grundbucheintrag nötig. |
|
Dauer |
Lebenslang oder für einen festgelegten Zeitraum, auch über die Scheidung hinaus. |
Meist befristet auf die Trennungszeit oder bis zur endgültigen Vermögensaufteilung. |
|
Vorteile |
Bietet langfristige Sicherheit und Wohnstabilität. |
Ermöglicht eine flexible Übergangsphase, z.B. für den Verbleib im Familienhaus. |
|
Nachteile |
Die Immobilie ist nicht frei verkäuflich oder vermietbar. Eine Wertminderung ist möglich. |
Eine Nutzung kann finanzielle Ansprüche (z.B. Nutzungsentschädigung) auslösen. |
|
Ende des Rechts |
Mit Ablauf der vereinbarten Dauer oder bei Verzicht durch den Berechtigten. |
In der Regel mit der Scheidung oder bei neuer Einigung der Ehepartner. |
Bleibt nach einer Scheidung oder Trennung einer der Partner allein im gemeinsamen Haus wohnen, während der andere auszieht, kann Letzterer eine Nutzungsentschädigung verlangen. Sie soll den wirtschaftlichen Nachteil ausgleichen, da der ausgezogene Partner die Immobilie nicht mehr mitnutzen kann. Zahlungspflichtig ist dabei immer der Partner, der die Immobilie allein nutzt. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem objektiven Mietwert des Hauses oder der Wohnung und kann anteilig festgelegt werden. Eine Nutzungsentschädigung kommt sowohl bei gemeinsamem Eigentum als auch bei Alleineigentum infrage, sofern der andere Ehepartner über ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht verfügt.
immoverkauf24 Hinweis
Die Zahlung der Nutzungsentschädigung kann auch gerichtlich eingefordert werden, wenn keine Einigung gelingt. So bleibt die Aufteilung der Immobilie bei Scheidung rechtlich und wirtschaftlich ausgewogen.
6. Was passiert bei einer Scheidung mit dem laufenden Hauskredit?
Bei einer Scheidung mit Haus bleibt die finanzielle Verantwortung für den laufenden Immobilienkredit zunächst unverändert. Entscheidend ist nicht, wer im Grundbuch steht, sondern wer den Kreditvertrag unterschrieben hat. Haben beide Ehepartner gemeinsam finanziert, haften sie auch weiterhin gemeinsam gegenüber der Bank – unabhängig davon, wer in der Immobilie wohnt oder sie nutzt. Solange keine Umschreibung erfolgt, müssen beide Partner die Raten weiterzahlen.
Möchte einer der Ehepartner das gemeinsame Haus nach der Scheidung behalten, kann er den Kredit übernehmen und die andere Partei ausbezahlen. Wird das Haus bei Scheidung verkauft, dient der Verkaufserlös meist dazu, den Kredit vollständig zu tilgen – verbleibendes Kapital wird anschließend zwischen den Ehepartnern aufgeteilt.
Immobilienfinanzierung bei Übernahme eines Partners nach der Trennung
Bleibt einer der Ehepartner in der Immobilie wohnen und möchte den Kredit allein weiterführen, muss die Bank der Übernahme ausdrücklich zustimmen. Dafür wird eine erneute Bonitätsprüfung durchgeführt, die die Kreditwürdigkeit des verbleibenden Partners sicherstellt. Ist das Einkommen ausreichend, kann die Bank den Vertrag auf eine Person umschreiben. Andernfalls droht eine Kündigung der bestehenden Finanzierung – meist mit einer Vorfälligkeitsentschädigung. Alternativ kann ein neuer Kredit abgeschlossen werden, der die bestehende Restschuld ablöst. Auch hier empfiehlt sich ein aktueller Vergleich von Konditionen, da die Zinsen seit 2022 deutlich gestiegen sind und die monatliche Belastung höher ausfallen kann.
Was passiert bei einer Scheidung mit dem Bausparvertrag?
Ein gemeinsamer Bausparvertrag zählt ebenfalls zum Vermögen, das bei einer Scheidung aufgeteilt wird. Sind beide Ehepartner als Inhaber eingetragen, steht ihnen jeweils die Hälfte des angesparten Guthabens zu. Der Vertrag kann nur mit Zustimmung beider Seiten aufgelöst werden. Wird der Bausparvertrag vorzeitig beendet, berechnet die Bank in der Regel Gebühren zwischen 0,1 und 1 Prozent der Bausparsumme pro verbleibendem Monat bis zur Zuteilungsphase.
Alternativ kann das Guthaben auch im Zuge des Zugewinnausgleichs verrechnet werden – etwa, wenn einer den Bausparvertrag übernimmt und der andere eine Ausgleichszahlung erhält.
7. Steuern bei der Scheidung mit Haus: Was gilt es steuerrechtlich zu beachten?
Bei einer Scheidung mit Haus stellen sich nicht nur Fragen zu Eigentum und Finanzierung, sondern auch zu den steuerlichen Folgen. Wer seine Immobilie bei einer Trennung verkauft, überträgt oder übernimmt, muss mögliche Steuerpflichten im Blick behalten – insbesondere die Spekulationssteuer, die Schenkungssteuer und die Grunderwerbsteuer. Eine sorgfältige steuerliche Planung kann helfen, unnötige Kosten zu vermeiden und finanzielle Nachteile zu verhindern.
-
Spekulationssteuer beim Hausverkauf nach Scheidung
Wird das gemeinsame Haus nach der Scheidung verkauft, kann der Verkauf steuerpflichtig sein, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre vergangen sind (§ 23 EStG). Diese sogenannte Spekulationssteuer fällt auf den Gewinn an, der durch den Verkauf erzielt wurde. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie das Haus im Jahr des Verkaufs und in den beiden vorangegangenen Jahren selbst bewohnt haben – dann bleibt der Verkauf steuerfrei.
Nach Ablauf der Zehnjahresfrist ist ein Verkauf immer steuerfrei. Den erzielten Verkaufsgewinn müssen Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung unter „Sonstige Einkünfte“ angeben. Wie stark sich der Gewinn dann auf Ihre Steuerlast auswirkt, hängt von Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz ab.
-
Steuern bei Übertragung oder Schenkung an den Ex-Partner
Wenn ein Ehepartner die Immobilie nach der Scheidung übernimmt und den anderen auszahlt, entsteht steuerlich kein Nachteil – der Ausgleich wird als Vermögensübertragung im Rahmen der Scheidung behandelt.
Wird das Haus dagegen verschenkt, kann die Schenkungssteuer anfallen. Für Schenkungen unter Ehepartnern gilt ein Freibetrag von 500.000 Euro. Wird das Haus vor der rechtskräftigen Scheidung übertragen, bleibt die Schenkung in der Regel steuerfrei, solange der Immobilienwert diesen Betrag nicht überschreitet. Erfolgt die Übertragung erst nach der Scheidung, kann der Freibetrag deutlich geringer ausfallen, und die Schenkungssteuer wird fällig.
-
Grunderwerbsteuer vermeiden durch rechtzeitige Übertragung
Überträgt ein Ehepartner während der Ehe oder im Zuge der Scheidung seinen Eigentumsanteil an den anderen, fällt keine Grunderwerbsteuer an – vorausgesetzt, die Übertragung erfolgt vor der Scheidung. Erfolgt sie erst danach, gilt diese Befreiung nicht mehr, und das Finanzamt kann die Grunderwerbsteuer verlangen. Deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige notarielle Regelung, um zusätzliche Kosten beim Hausbesitz zu vermeiden.
immoverkauf24 Tipp
Ein Verkehrswertgutachten schafft Klarheit über den tatsächlichen Wert Ihrer Immobilie bei Scheidung. Es dient als Basis für faire Auszahlungen, steuerliche Berechnungen und sichere Entscheidungen beim Hausverkauf.
8. Welche Kosten entstehen bei einer Scheidung mit Hausbesitz?
Eine Scheidung mit Haus verursacht meist deutlich höhere Kosten als eine Trennung ohne Immobilie. Der Grund: Häuser oder Eigentumswohnungen erhöhen den sogenannten Verfahrenswert, auf dessen Basis sowohl Gerichts- als auch Anwaltskosten berechnet werden. Je höher der Immobilienwert, desto teurer das gesamte Scheidungsverfahren. Hinzu kommen mögliche Ausgaben für Gutachten, Bewertungen, Kreditablösungen oder die Auszahlung des Hauses bei Trennung. Wird zusätzlich über Wohnrecht, Nutzung oder Verkauf gestritten, steigen die Kosten weiter an, da jedes Thema als Folgesache gilt und separat berechnet wird. Wer frühzeitig klare Vereinbarungen trifft, kann diese Zusatzkosten oft vermeiden.
Beispiel: Berechnung der Kosten bei Scheidung mit Haus
Diese beispielhafte Rechnung zeigt, welche Kostenpositionen und mögliche Scheidungskosten bei Hausbesitz auf Sie zukommen können. Die genutzten Zahlen dienen als Beispiel und können, abhängig von Immobilienwert, Einkommen, Verfahrensdauer und Einigungsbereitschaft, deutlich variieren.
Als Grundlage für die Berechnung von Anwalts- und Gerichtskosten wird der Verfahrenswert herangezogen. Er setzt sich zusammen aus drei Netto-Monatseinkommen beider Partner, zzgl. 2 - 5 % des Verkehrswerts (je nach Streitumfang). Für das folgende Beispiel beläuft sich der Immobilienwert auf 400.000 €, das monatliche Nettoeinkommen liegt bei 4.000 €. Es wird also gerechnet:
- Verfahrenswert = (3 x 4.000 €) + (400.000 € * 0,03) = 24.000 €
| Kostenart | Erläuterung | Beispielwert |
|
Gerichtskosten |
Das Familiengericht berechnet seine Gebühren nach dem Verfahrenswert. Beide Ehepartner tragen diese Kosten zu gleichen Teilen. |
ca. 2.000 - 2.500 € (ca. 1.000 - 1.250 € pro Person) |
|
Anwaltskosten |
Jede Partei hat in der Regel eine eigene anwaltliche Vertretung. Die Gebühren richten sich ebenfalls nach dem Verfahrenswert und dem Umfang der Folgesachen (z.B. Haus, Zugewinn, Unterhalt). |
ca. 5.000 - 6.000 € pro Anwalt |
|
Verkehrswertgutachten |
Dient zur objektiven Feststellung des Immobilienwerts, etwa bei Auszahlung oder Verkauf. Die Kosten variieren nach Gutachter und Aufwand. |
ca. 1.000 - 2.000 € |
|
Notar- und Grundbuchkosten |
Fallen an, wenn die Immobilie verkauft, übertragen oder ein Eigentümer ausgezahlt wird. Grundlage sind 1,0 - 1,5 % des Immobilienwerts. |
ca. 6.000 € |
Scheidungskosten reduzieren dank Scheidungsfolgenvereinbarung
Eine einvernehmliche Lösung spart bares Geld. Mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung lassen sich zentrale Punkte wie Hausübertragung, Auszahlung eines Partners oder die Aufteilung des Immobilienvermögens bereits vor dem Gerichtstermin regeln. Das reduziert nicht nur Streit, sondern auch den Verfahrenswert – und damit die gesamten Kosten der Scheidung mit Hausbesitz.
Auch ein bereits bestehender Ehevertrag kann helfen, hohe Ausgaben zu vermeiden, indem er klare Regelungen zu Eigentum, Kredit und Vermögensausgleich enthält. Grundlage jeder Vereinbarung sollte ein Verkehrswertgutachten sein, das den realen Marktwert der Immobilie bei Scheidung objektiv feststellt. So behalten beide Parteien den Überblick – und verhindern, dass die Scheidung unnötig teuer wird.
9. Trennung oder Scheidung – Welche Unterschiede gelten für Immobilien?
Ob Trennung oder Scheidung – bei einer gemeinsamen Immobilie sind rechtliche, steuerliche und finanzielle Unterschiede entscheidend. Während die Trennung mit Haus zunächst nur das Zusammenleben betrifft, führt die Scheidung zur endgültigen rechtlichen Auflösung der Ehe – mit Folgen für Eigentum, Steuern und mögliche Auszahlungen. Im Trennungsjahr bleibt die Immobilie gemeinsames Eigentum, es gilt jedoch die Pflicht, getrennt zu wirtschaften. Erst mit der Scheidung werden Eigentumsverhältnisse und Vermögen verbindlich aufgeteilt. Wer frühzeitig klare Vereinbarungen trifft, kann hohe Kosten und spätere Konflikte vermeiden.
Das gilt in der Trennungsphase für Immobilien
Bevor ein Scheidungsverfahren eingeleitet wird, müssen Ehepartner in der Regel ein Trennungsjahr nachweisen. Das Gericht erkennt die Trennung nur an, wenn die Partner getrennt leben und wirtschaften – entweder in unterschiedlichen Wohnungen oder innerhalb eines Hauses mit vollständig getrennter Haushaltsführung. Getrennt zu wirtschaften bedeutet in diesem Fall: keine gemeinsamen Mahlzeiten, getrennte Einkäufe und getrennte Zimmer.
Wer nach der Trennung im gemeinsamen Haus wohnen bleibt, profitiert von einem sogenannten Wohnvorteil. Dieser entsteht, wenn der in der Immobilie verbleibende Partner dort günstiger wohnt als in einer vergleichbaren Mietwohnung. Der Wohnvorteil gilt als geldwerter Vorteil, kann sich steuerlich auswirken und ist bei Unterhaltsberechnungen relevant. Gleichzeitig muss der verbleibende Partner sämtliche Haus- und Grundstückskosten sowie Zinslasten alleine tragen.
Wichtiger Unterschied: Immobilienverkauf während und nach der Trennung
Besonders der Zeitpunkt des Hausverkaufs ist entscheidend für die steuerliche Behandlung. Verkaufen Sie die Immobilie während der Trennung, bleibt der Gewinn in der Regel steuerfrei, wenn Sie oder Ihr Ex-Partner diese im Verkaufsjahr oder in den beiden Jahren davor noch selbst bewohnt haben. Erfolgt der Verkauf jedoch erst nach der Scheidung und hat keiner der Ehepartner das Haus in diesem Zeitraum selbst genutzt, kann der Gewinn steuerpflichtig werden. In diesem Fall greift die sogenannte Spekulationssteuer, sofern die Immobilie noch keine zehn Jahre im Besitz war. Der Verkaufszeitpunkt sollte daher sorgfältig geplant werden.
10. Fazit: Wie sieht der ideale Ablauf bei einer Scheidung mit Haus aus?
Eine Scheidung mit Haus ist oft die größte finanzielle und emotionale Herausforderung im Trennungsprozess. Umso wichtiger ist ein klarer, strukturierter Ablauf, der Konflikte vermeidet und Kosten spart. Idealerweise gehen Sie dabei in mehreren Schritten vor – mit Weitblick für Ihre familiäre Situation, eventuelle Kinder und Ihre finanzielle Zukunft.
- Bestandsaufnahme der Immobilie: Klären Sie, wem das Haus gehört, ob es in die Ehe eingebracht oder gemeinsam erworben wurde. Prüfen Sie Kredit-, Grundbuch- und Eigentumsunterlagen. Eine professionelle Bewertung liefert den Marktwert als Basis für faire Entscheidungen bei Verkauf oder Auszahlung.
- Einvernehmliche Lösungen finden: Sprechen Sie offen über die Zukunft der Immobilie. Ein gemeinsamer Verkauf oder eine klare Vereinbarung sparen Zeit, Geld und Nerven. Eine frühzeitige Scheidungsfolgenvereinbarung regelt Eigentum, Ausgleich und Unterhalt verbindlich.
- Familiäre Bedürfnisse beachten: Bei gemeinsamen Kindern sollte Stabilität Vorrang haben. Oft bleibt der betreuende Elternteil zunächst im Haus. Zwischenlösungen wie Vermietung oder befristete Nutzung können helfen, bis Klarheit besteht.
- Finanzen und Steuern klären: Besprechen Sie Hauskredit, Zugewinnausgleich und mögliche Steuern frühzeitig mit Bank und Steuerberater. Wer die Immobilie übernimmt, benötigt eine gesicherte Finanzierung und die Zustimmung der Bank.
- Langfristig planen: Überlegen Sie, ob Verkauf, Vermietung oder Übertragung am sinnvollsten ist – auch steuerlich. Eine realistische Planung schafft Sicherheit und legt den Grundstein für einen finanziell stabilen Neuanfang.
Jetzt kostenlose Maklerempfehlung bei Trennung & Scheidung einholen!
Sie möchten wissen, welcher Makler in Ihrem Ort zu empfehlen ist und sich mit Immobilien bei Scheidungen oder in Trennungsfällen auskennt? Gerne empfehlen wir Ihnen einen anerkannten und vertrauenswürdigen Makler.
Einfach Formular ausfüllen – Maklerempfehlung kostenfrei und unverbindlich erhalten:
Maßgeblich bei der Aufteilung des Hauses bei Scheidung sind Grundbuch und Güterstand. Bei Miteigentum entscheiden Sie einvernehmlich, ob Sie verkaufen wollen oder ein Partner das Haus gegen Auszahlung übernimmt. Ohne Einigung bleibt meist nur die Teilungsversteigerung. Zugewinnausgleich und laufende Darlehen werden mitberücksichtigt.
Richtschnur ist der aktuelle Verkehrswert der Immobilie minus Restschuld. Die verbleibende Summe wird hälftig geteilt – diesen Anteil erhält der Ausziehende. Grundlage ist idealerweise ein Sachverständigengutachten. Nebenkosten wie Notar, Grundbuch und ggf. Vorfälligkeitsentschädigung sollten in die Finanzplanung einfließen.
Ohne Einigung bleiben beide Partner Miteigentümer des Hauses. Übliche Lösungen sind der gemeinsame Verkauf, die Auszahlung eines Partners oder die Realteilung. Wer Alleineigentümer im Grundbuch ist, behält die Immobilie, muss wertsteigernde Zugewinne meist aber ausgleichen. Kinderinteressen, Nutzungsrechte und Finanzierung sind mitzuprüfen.
Um das Haus nach Scheidung zu behalten, übernehmen Sie den Miteigentumsanteil des Ex-Partners gegen Auszahlung und tragen eventuelle Kredite künftig allein. Dafür braucht es die Zustimmung der Bank (Bonitätsprüfung, ggf. Umschuldung). Ein belastbares Wertgutachten, klare Regelungen in einer Scheidungsfolgenvereinbarung und Steuercheck sichern die Entscheidung ab.
Zusätzlich zu Gerichts- und Anwaltskosten fallen oft Gutachten-, Notar- und Grundbuchgebühren, ggf. Vorfälligkeitsentschädigung, Maklerkosten und Steuern (z.B. Spekulationssteuer) an. Die Gesamthöhe der Kosten bei Hausbesitz hängt vom Verfahrenswert, Immobilienwert, Einigungsbereitschaft und der gewählten Lösung (Verkauf, Auszahlung, Übertragung) ab.
Nur, wenn Sie seinen Anteil übernehmen möchten. Bei Miteigentum gibt es Alternativen, z.B. den gemeinsamen Verkauf mit Erlösteilung oder die Teilungsversteigerung als Notlösung. Bei Alleineigentum besteht kein Anspruch am Haus, jedoch ggf. auf Zugewinnausgleich oder Nutzungsentschädigung während der Trennungszeit.

